- Blog
- 17+Aufstiegs der KI: neue Formen der sc...
17+Aufstiegs der KI: neue Formen der schulischen Leistungsbewertung
Einleitung
Die Digitalisierung prägt mittlerweile alle Lebensbereiche, und ihre Dynamik erfasst seit Jahren auch das deutsche Schulsystem – teils holprig, oft kontrovers diskutiert und mittlerweile von einem Trend dominiert: Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI). Was 2022 noch als Querdenker-Experiment galt, ist 2025 unverzichtbare Praxis und Katalysator für grundlegenden Wandel in Unterrichtsgestaltung, Lernalltag sowie der Leistungsbewertung selbst. Innerhalb weniger Jahre haben Lernplattformen, KI-basierte Tutoring-Systeme und automatische Prüfungs-Algorithmen den pädagogischen Alltag revolutioniert. Lehrkräfte und Schüler:innen stehen so vor neuen Chancen – und ehrlichen Herausforderungen.
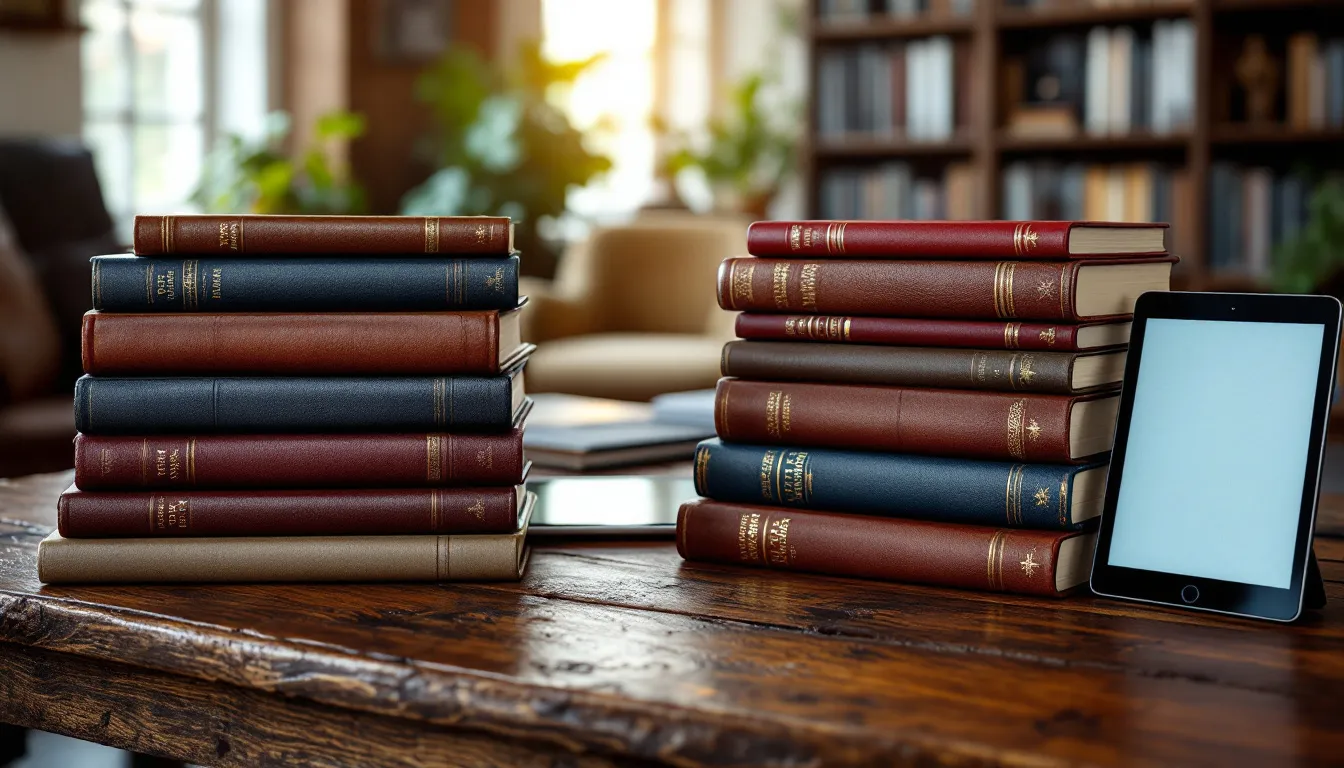
Inhaltsverzeichnis
Doch wie definieren wir schulische Leistung in einer KI-geprägten Gegenwart? Wie verändern sich Prüfungen, Noten, und das allgemeine Bild von „Kompetenz“? Der jüngste „GoStudent Bericht zur Zukunft der Bildung 2025“ liefert dazu zentrale Erkenntnisse. Als führender Nachhilfe- und EdTech-Anbieter in Europa fungiert unser Partner GoStudent als Vorreiter und liefert mit seinem Report belastbare Zahlen sowie detaillierte Einblicke aus über 5.859 Befragungen unter Eltern, Schüler:innen und Lehrkräften. Daten aus dieser Studie stützen die nachfolgenden Analysen und finden direkte Erwähnung im Text, damit die Realität in Schulen transparent wird.
Key Takeaways
-
62% der Eltern in Deutschland sind überzeugt, dass neue Formen der schulischen Leistungsbewertung notwendig sind, und klassische Prüfungen und Noten das wahre Kompetenzniveau der Kinder oft nicht abbilden.
-
60% der Schüler:innen geben an, sich besser mit KI auszukennen als ihre Lehrkräfte, und 52% fühlen sich durch die Schule nicht ausreichend auf die Berufswelt vorbereitet.
-
74% der Lehrkräfte befürworten simulationsbasierte Leistungsbewertungen (Simulation-Based Assessments, SBA) gegenüber traditionellen Tests.
-
Die Herausforderungen reichen von ungenügender Fortbildung für Lehrkräfte (75% erhalten keine KI-Trainings) bis zu neuen Risiken wie Fehlinformationen – 47% der Schüler:innen werden laut Lehrkräften davon beeinflusst.
-
KI-gestützte Bewertungsmethoden könnten die Bildung gerechter, individualisierter und inklusiver machen, doch offenen Fragen und regulatorische Unsicherheit bleiben bestehen.
Wandel der Leistungsbewertung in KI-Zeiten
Die Einführung von KI im Schulbereich sorgt für einen Paradigmenwechsel. Prüfungen, benotete Hausaufgaben und mündliche Leistungsnachweise beschreiben zunehmend die Vergangenheit, während flexible, kompetenzorientierte Modelle entstehen. 62% der Eltern beobachten, dass klassische Noten die Fähigkeiten ihrer Kinder nicht realistisch widerspiegeln – sie plädieren für innovative Bewertungsformate. Fast zwei Drittel der Befragten nennen simulationsbasierte Ansätze als Schlüssel zur Modernisierung.
KI-gestützte Methoden – darunter adaptive Testsysteme, automatische Aufgabenkorrekturen und simulierte Lernumgebungen – ermöglichen eine individualisierte Abfrage von Kompetenzen. Während klassische Prüfungen oft auf Auswendiglernen zielen, unterstützen KI-Werkzeuge die Verankerung von kritischem Denken, Kommunikationsfähigkeit und Problemlösung. 41% der Lehrkräfte kritisieren die Fixierung auf das Auswendiglernen. Stress (34%), eingeschränkte Kompetenzmessung (26%) und mangelnder Realitätsbezug (22%) sind weitere Kritikpunkte aus dem GoStudent-Bericht.
Der Trendmonitor KI in der Bildung 2025 analysiert, dass der Markt für KI-Anwendungen in deutschen Schulen sich seit 2021 verdreifacht hat, maßgeblich durch den Anstieg generativer KI-Tools wie ChatGPT und spezialisierter Tutoring-Systeme. KI kann laut Experten die Lernumgebung personalisieren, Lerninhalte adaptiv gestalten und Bildungsungerechtigkeiten abbauen. Das Potenzial solcher Ansätze hängt entscheidend davon ab, wie gut Schulen diese Möglichkeiten systematisch integrieren können – bisher existiert bei nur 23% aller Schulen eine zentrale KI-Regelung.
Lehrkräfte sehen in KI-zentrierten Prüfungsansätzen oft Entlastung von Routineaufgaben: Korrigieren, Bewerten und Feedback sind im Idealfall automatisiert, sodass mehr Zeit für pädagogische Interaktion bleibt. Gleichzeitig sind KI-Anwendungen dazu in der Lage, handschriftliche Schulaufgaben mittels Schrifterkennung zu bewerten und differenzierte Beurteilungstexte vorzuschlagen. Doch diese Prozesse bleiben nicht ohne Skepsis: Die Mehrheit der deutschen Lehrkräfte beurteilt den Einfluss von KI im Klassenzimmer nach wie vor kritisch, trotz der offensichtlichen Produktivitätssteigerungen.
Chancen individualisierter Leistungsbewertung
Die Chancen, die KI-basierte Leistungsbewertung bietet, liegen vor allem in der Personalisierung. KI kann Stärken und Schwächen eines jeden Kindes genau erkennen, den Lernstand nicht nur punktuell, sondern über Zeit messen und vielschichtige Kompetenzprofile erstellen. Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte sind sich einig: 62% aller Befragten fordern neue Formen der Beurteilung, damit die individuellen Fähigkeiten nicht hinter starren Notensystemen verblassen.
Mit simulationsbasierten Assessments wird das Lernen näher an die Realität herangeführt. 74% der Lehrkräfte sehen diesen Ansatz als effektiver. Diese Leistungsbewertungen prüfen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Anwendung, Problemlösung und Zusammenarbeit in praktischen, oft digital simulierten Situationen. Dadurch entsteht ein rundes Kompetenzbild, das klassische Formate kaum leisten. Ein Beispiel: KI-Algorithmen bewerten Gruppenprojekte nach nicht nur Ergebnis, sondern auch nach Teamwork und Interaktionsmustern.

Im GoStudent Bildungsreport wird eine klare Schieflage der Vorbildung diagnostiziert: 75% der Lehrkräfte erhalten keine Weiterbildungsangebote zu KI, während 60% der Schüler:innen angeben, sich besser auszukennen. Dies führt dazu, dass viele innovative Bewertungsmodelle theoretisch zwar bekannt, praktisch aber kaum implementiert sind. Die GoStudent-Daten zeigen zudem, dass Kinder heute mehr über KI auf Social Media als in der Schule lernen – eine besorgniserregende Erkenntnis.
Individualisierte Bewertungen könnten in Zukunft Stress reduzieren, die klassische Prüfungsangst mindern und Kindern mehr Selbstvertrauen geben, statt sich mit Konkurrenzdruck auseinanderzusetzen. Besonders für „Sonderkinder“ – mit Lernschwächen, Hochbegabung oder Sprachbarrieren – bieten KI-basierte Verfahren faire Chancen, ihre Stärken sichtbar zu machen. 33% aller GoStudent-Schüler:innen erhalten für Lernangebote Unterstützung aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ (BuT), was zeigt, wie wichtig Teilhabe und Individualisierung im deutschen Nachhilfemarkt sind.
Risikofaktoren und Herausforderungen
Neben den Chancen birgt der KI-gestützte Wandel ernstzunehmende Herausforderungen. Zentrale Themen sind Datenschutz, Fehlbewertungen sowie die Gefahr einseitig trainierter Algorithmen, die soziale oder kulturelle Kompetenzen nicht wirkungsvoll abfragen können. Laut GoStudent-Report fühlen sich 52% der deutschen Eltern unsicher angesichts neuer Technologien in der Bildung, inklusive KI.
Besonders kritisch ist der Umgang mit Fehlinformationen: 47% der Lehrkräfte sagen, dass KI-gestützte Plattformen und Tools Fehlinformationen und „Fake News“ verstärken – oft ungewollt. 36% der Lehrer:innen beobachten, dass Falschnachrichten die Offenheit gegenüber anderen Kulturen beeinträchtigen; 31% der Familien sehen negative Auswirkungen auf die Werte ihrer Kinder. Hier sind Schutzmechanismen, digitale Medienkompetenz und transparente Algorithmen gefragt.
Die regulatorische Unsicherheit ist ein weiteres Risiko. Laut Bitkom gibt es in nur 23% der deutschen Schulen zentrale Regeln, während 35% der Lehrkräfte selbst Einzelentscheidungen zum KI-Einsatz treffen müssen. Dadurch entstehen Ungleichheiten: Während innovative Angebotsformen lokal entstehen, fehlt eine flächendeckende, nachhaltige Governance. Das Bundesinstitut für Berufsbildung sieht 2025 dringenden Forschungsbedarf, wie KI in der schulischen Leistungsbewertung so integriert werden kann, dass kein Kind benachteiligt wird.
Auch ethische Fragen stehen im Fokus: Ist ein Algorithmus, der mathematische Leistung objektiv erkennt, auch in der Lage Kreativität, Empathie oder soziale Kompetenz fair zu messen? Die Bildungsforschung betont, dass KI-basierte Systeme stets von Lehrkräften kontrolliert und ergänzt werden müssen, damit menschliche Faktoren nicht verloren gehen. 53% der Kinder sind überzeugt, dass Roboter bis 2050 zum Schulalltag gehören, während Eltern und Lehrkräfte eine Mischung aus Mensch und KI als optimal sehen.
Die Zukunft – Hybride Modelle und Soft Skills
Die Zukunft der schulischen Leistungsbewertung scheint hybrid: Menschliche Lehrkräfte kooperieren mit KI-Systemen, um Lernprozesse zu unterstützen, zu steuern und zu bewerten. 88% der österreichischen Lehrkräfte erhalten keine KI-Ausbildung, was jedoch von Eltern und Schüler:innen eingefordert wird. Immer mehr Experten fordern, die KI nicht als Ersatz, sondern als Empowerment für Lehrkräfte und personalisierte Lernwege zu begreifen.
Ein besonderer Fokus rückt auf Soft Skills – Kommunikation, Teamfähigkeit, Selbstmanagement und Empathie. Zwei Drittel der Eltern sind überzeugt, dass diese Kompetenzen in einer KI-geprägten Zukunft besonders wichtig werden. KI kann dabei helfen, Soft Skills besser zu erfassen, zu trainieren und zu bewerten; dies gelingt vor allem durch simulationsbasierte Szenarien und digitale Gruppenprojekte.

Hybride Lernmodelle, die Offline- und Online-Elemente verbinden, gewinnen deutlich an Bedeutung: Bei GoStudent lernen 125.000 Schüler:innen bereits in rund 900 Standorten nach einem solchen Modell. Die Analytics und KI-Algorithmen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege, flexible Prüfungsformate und kontinuierliche Lernstandserhebung. Lehrer:innen erhalten automatisierte Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen ihrer Klasse, und Eltern können Lernfortschritt transparent mitverfolgen.
Dennoch bleibt zu betonen: Führung, Ethik und Verantwortung liegen beim Menschen. KI ist und bleibt ein Werkzeug, das den pädagogischen Rahmen bereichern kann – wenn es umsichtig und kontrolliert eingesetzt wird.
Fazit
Die kontinuierliche Integration der KI in schulische Bewertungsmodelle ist unumkehrbar und eröffnet der deutschen und europäischen Bildungslandschaft enorme Chancen. Die aktuellen Daten von unserem Partner GoStudent und anderen Institutionen zeigen, dass die Mehrheit der Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte neue, innovative Wege in der Leistungsbewertung wünscht, klassische Prüfungen kritisch sieht und simulationsbasierte, individualisierte Formate favorisiert.
Gleichzeitig muss der Rechts-, Fortbildungs- und Ethikrahmen dringend weiterentwickelt werden, um Risiken wie Fehlinformationen, Konformitätsdruck und algorithmische Diskriminierung zu mindern. Die KI wird die Lehrkräfte nicht ersetzen, sondern dazu befähigen, mehr Zeit für pädagogische Aufgaben und persönliche Förderung ihrer Schüler:innen zu widmen.
Die hybride Lernlogik, welche analoge und digitale Methodik sinnvoll kombiniert, zeigt sich als robustes Modell für die Zukunft. Leistungsbewertung bleibt dabei ein dynamisches System, das sich mit gesellschaftlichen, technologischen und didaktischen Entwicklungen kontinuierlich verändern muss.
Abschluss
Die Reise der KI als Schlüsseltechnologie im deutschen Bildungssektor hat gerade erst begonnen. Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte – wie die GoStudent-Studie 2025 eindrucksvoll belegt – sind bereit für den Umbruch, sind neugierig und zugleich kritisch. Innovative Leistungsbewertungen, eine Stärkung der Soft Skills und integrative hybride Modelle werden die Schule der Zukunft bestimmen. Den Wandel verantwortungsvoll zu gestalten und alle positiven Potenziale auszuschöpfen, wird zur Kernaufgabe aller Akteure. Die Bildungslandschaft 2025 zeigt damit: Nicht Technik allein entscheidet Erfolg, sondern das reflektierte Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
Jeder Zahlenwert im Blog ist mit einer zugehörigen Quellenangabe versehen. Die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse stammen aus dem aktuellen Bildungsreport unseres Partners GoStudent.

